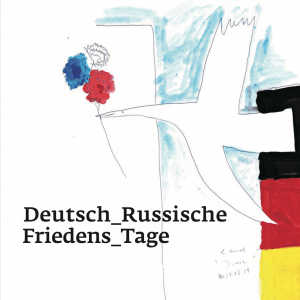- Details
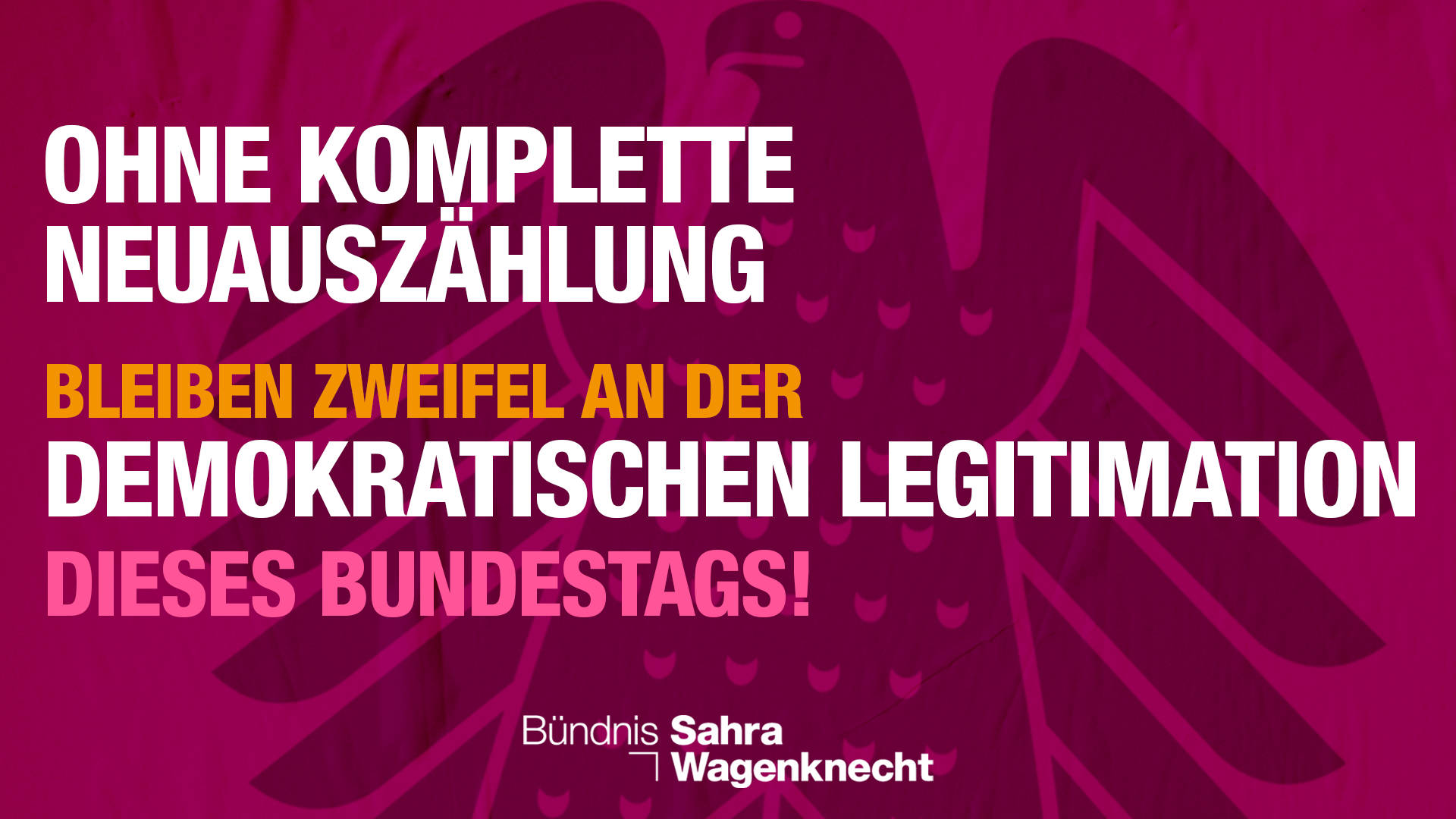 Dem BSW sollen nach dem amtlichen Endergebnis nur 9.529 Stimmen bzw. 0,19 Promille zum Einzug ins Parlament gefehlt haben. Aber sind im amtlichen Endergebnis alle Stimmen richtig gezählt worden? Das ist extrem unwahrscheinlich. Denn es wurde bisher so gut wie keine der rund 90.000 Wahlurnen komplett neu ausgezählt! Und das BSW erhielt schon allein durch die wenigen vereinzelten Überprüfungen, die vor der Feststellung des amtlichen Endergebnisses stattgefunden haben, 4.277 Stimmen dazu. Das waren deutlich mehr als bei jeder anderen Partei. Warum sollen sich die dafür verantwortlichen Gründe nicht in jedem Wahllokal ausgewirkt haben? Wie viele Stimmen insgesamt zu Lasten des BSW falsch gezählt wurden, ist deshalb ohne komplette Neuauszählung nicht zu beantworten.
Dem BSW sollen nach dem amtlichen Endergebnis nur 9.529 Stimmen bzw. 0,19 Promille zum Einzug ins Parlament gefehlt haben. Aber sind im amtlichen Endergebnis alle Stimmen richtig gezählt worden? Das ist extrem unwahrscheinlich. Denn es wurde bisher so gut wie keine der rund 90.000 Wahlurnen komplett neu ausgezählt! Und das BSW erhielt schon allein durch die wenigen vereinzelten Überprüfungen, die vor der Feststellung des amtlichen Endergebnisses stattgefunden haben, 4.277 Stimmen dazu. Das waren deutlich mehr als bei jeder anderen Partei. Warum sollen sich die dafür verantwortlichen Gründe nicht in jedem Wahllokal ausgewirkt haben? Wie viele Stimmen insgesamt zu Lasten des BSW falsch gezählt wurden, ist deshalb ohne komplette Neuauszählung nicht zu beantworten.
weiterlesen bei https://bsw-vg.de
- Details
 Der Bundesrat hat den Weg frei gemacht für das wahnwitzigste Aufrüstungsprogramm und den größten Wahlbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik. Anstatt auf die Barrikaden zu gehen, steht die Linke Spalier. Schon im Bundestag hätte die Linke mehr tun können, um diesen Schuldenrausch zu verhindern. Dass sie im Bundesrat diesen Kriegskrediten auch noch zustimmt, ist ein riesiges Versagen. Bremen stimmte im Bundesrat der Milliarden-Aufrüstung zu. Der Bremer SPD-Bürgermeister Bovenschulte im Bundesrat: "Mein besonderer Dank dafür gilt den Koalitionspartnern Grüne und Die Linke."
Der Bundesrat hat den Weg frei gemacht für das wahnwitzigste Aufrüstungsprogramm und den größten Wahlbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik. Anstatt auf die Barrikaden zu gehen, steht die Linke Spalier. Schon im Bundestag hätte die Linke mehr tun können, um diesen Schuldenrausch zu verhindern. Dass sie im Bundesrat diesen Kriegskrediten auch noch zustimmt, ist ein riesiges Versagen. Bremen stimmte im Bundesrat der Milliarden-Aufrüstung zu. Der Bremer SPD-Bürgermeister Bovenschulte im Bundesrat: "Mein besonderer Dank dafür gilt den Koalitionspartnern Grüne und Die Linke."
Nur das BSW steht konsequent für Frieden und gegen Aufrüstung. Daher haben Brandenburg und Thüringen heute im Bundesrat den Kriegskrediten ihre Stimme verweigert.
Nach dem Schuldenpaket ist vor dem Kürzungspaket: Sozialabbau und harte Einschnitte bei Rente, Pflege und Gesundheit werden die Folge sein. Dies ist nicht nur ein großer Wahlbetrug, sondern künftige Generationen werden die Schulden für die Panzer noch abbezahlen, wenn diese längst verrostet sind. Mindestens 30 Mrd. Euro müssen die Steuerzahler künftig jedes Jahr allein für die Zinsen aufbringen.
Dieses Schuldenpaket für Aufrüstung ist ein historischer Fehler!
- Details
Für fünf Prozent der Parlamentssitze genügen weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen / Verfassungsgericht: Sperrklausel dient parlamentarischer Arbeitsfähigkeit durch Fraktionsbildung / Fraktionsstatus ab fünf Prozent Sitzanteil / Mathematiker: BSW erfüllt Bedingungen
(Dieser Beitrag wurde am 28. Februar 2025 bei multipolar veröffentlicht.)
Die derzeitige Anwendung der Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen in Deutschland widerspricht der geltenden Rechtsprechung. Darauf weist der Mathematiker Jens Winkler in einer Ausarbeitung hin, die Multipolar vorliegt. Mathematisch sei es möglich, die fünf Prozent sowohl auf den Anteil aller abgegebenen Zweitstimmen als auch auf den Anteil der Parlamentssitze zu beziehen, erläutert Winkler. Nur die zweite Möglichkeit entspreche jedoch der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts. Um einen Sitzanteil von fünf Prozent im Parlament zu erreichen, genügen beim Zweitstimmenanteil in der Regel bereits einige Zehntelprozentpunkte unter fünf Prozent. Der genaue Wert hängt vom Wahlergebnis ab und muss iterativ – also in schrittweise sich wiederholenden Rechengängen – für jede weitere Partei unter fünf Prozent ermittelt werden. Er liegt immer bei weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen. Grund ist die Nicht-Berücksichtigung der Stimmen für „sonstige“ Parteien. Dies sei ein Detail der Prozentrechnung, das bisher anscheinend unbeachtet geblieben ist, erläuterte Winkler gegenüber Multipolar.
Der Mathematiker weist darauf hin, dass das BSW mit einem Anteil von 4,972 Prozent der Zweitstimmen fünf Prozent der Bundestagssitze erhalten und daher mit Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen würde. Das Bundesverfassungsgericht begründe die Sperrklausel mit der Verhinderung eines in Gruppen zersplitterten Parlaments. Die Richter sehen – beispielsweise in einem Urteil aus dem Jahr 2024 – den einzigen Grund für die Legitimation einer ansonsten „verfassungswidrigen Sperrklausel“ darin, dass diese als Mindestgröße von Abgeordneten-Zusammenschlüssen dient. Die Fraktionen, deren Status sich aus einem Sitzanteil von mindestens fünf Prozent ergibt, sicherten „die Funktionsfähigkeit des Bundestages“.
Die Höhe der Sperrklausel von fünf Prozent der bundesweiten gültigen Zweitstimmen sei „für diesen Zweck sachgerecht“, erklärten die Verfassungsrichter. „Aber fünf Prozent der Zweitstimmen ist nicht exakt das gleiche wie fünf Prozent der Parlamentssitze“, sagte Winkler im Gespräch mit Multipolar. Die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts beziehe sich stets auf die Arbeit des Parlaments und auf die Fraktionsdefinition. Angesichts der Begründung für die Legitimität der Sperrklausel habe der Gesetzgeber die Grenze mit der Festlegung auf fünf Prozent der Zweitstimmen „willkürlich“ verschärft, kritisiert er. Es handele sich hier um eine mathematische „Lücke“, die jedoch regelmäßig Parteien betreffe. Bei der Bundestagswahl 2021 wäre auch die Linke (4,9 Prozent) betroffen gewesen, wenn sie nicht drei Direktmandate errungen hätte. („Grundmandatsklausel“) Bei der Wahl 2013 fielen FDP (4,8 Prozent) und AfD (4,7 Prozent) in die Lücke. Bei Landtagswahlen habe es zahlreiche weitere Fälle gegeben.
Zudem hat das Verfassungsgericht in seinem Urteil von 2024 festgehalten, dass es zur „Sicherstellung der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Bundestages“ nicht notwendig sei, eine Partei vom Bundestag auszuschließen, deren Abgeordnete eine gemeinsame Fraktion mit den Abgeordneten einer anderen Partei bilden würden. Dies gelte dann, wenn beide Parteien gemeinsam das Fünf-Prozent-Quorum erreichen. Die Ausnahme ermöglicht es beispielsweise der CSU, auch mit einem Zweitstimmenanteil von weniger als fünf Prozent in den Bundestag einzuziehen.
Die Verfassungsrichter hatten in ihrer Entscheidung außerdem darauf hingewiesen, dass eine Sperrklausel von fünf Prozent generell nicht mit dem Grundgesetz (Artikel 38: Gleichheit der Wahl und Artikel 21: Chancengleichheit der Parteien) vereinbar ist. Der Verein „Mehr Demokratie“ wertete das Urteil als Begründung für eine Absenkung der Fünf-Prozent-Hürde. Denn an der Sperrklausel scheiterten „Millionen von Stimmen der Wählerinnen und Wähler“, die dann nicht im Bundestag repräsentiert seien. Der Verein hatte zur Entscheidung des Verfassungsgerichts mit einer Bürgerklage gegen die von der Ampel-Koalition eingebrachte Reform des Bundeswahlgesetzes beigetragen. Dagegen hatten unter anderem auch die Bayrische Staatsregierung, die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie die Linke geklagt.